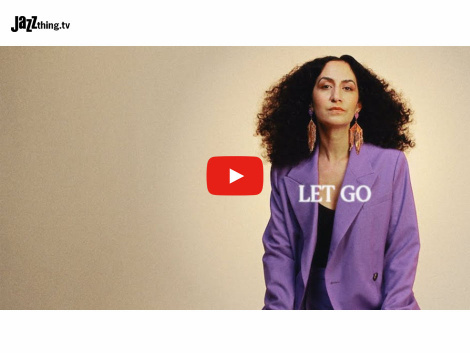Studie: Musikfestivals in Deutschland

Rund 1.800 Festivals unterschiedlicher Genres gibt es in Deutschland. Den Intendant/-innen und künstlerischen Leiter/-innen wurde ein Katalog mit 80 Fragen zugeschickt, die die verschiedenen Aspekte der Organisation eines Musikfestivals thematisierten. Fast 40 Prozent der Festivalmacher/-innen haben diesen Katalog vollständig beantwortet. „Die erzielte Rücklaufquote ist im Kontext wissenschaftlicher Erhebungen in der Kultur- und Veranstaltungsbranche als gut einzustufen“, schreiben die Macher/-innen: „Die Daten dieser Vollerhebung sind als repräsentativ für die Festivalbranche insgesamt zu werten.“
Die Zahlen: 71 Prozent der Musikfestivals sind der Popularmusik mit ihren Subgenres wie Elektronischer Musik und Jazz zuzuordnen, 24 Prozent der Klassischen Musik mit Alter und Neuer Musik. Die Festivals zeigen sich mit ihren Programmen stilistisch und ästhetisch divers, zudem bieten 81 Prozent dem Publikum auch ein teils nichtmusikalisches Rahmenprogramm. Im Schnitt dauern Klassikfestivals 13 Tage, Festivals der Popularmusik nur drei. Während der Festivalzeit finden in der Regel 30 Konzerte statt; auf’s Jahr hochgerechnet bieten die Festivals in Deutschland gut 51.000 Konzerte dem Publikum.
Auffällig ist, dass die Musikfestivals gar nicht so sehr in den großen Metropolen stattfinden, sondern das Gros in Städten mit weniger als 100.000 Einwohner/-innen. Das Alter des Publikums hängt vom jeweiligen Genre ab: Popfestivals wenden sich an ein eher jüngeres Publikum, während Jazz Menschen ab 45 Jahre anspricht und Klassik ab 60 Jahre. In der Finanzierung unterscheiden sich die Festivals: Setzen Klassik- und Jazzfestivals primär auf eine Förderung durch die öffentliche Hand (40 Prozent), so sind Ticketverkäufe die Haupteinnahmequelle der Popfestivals (39 Prozent). Auffällig ist mit 79 Prozent der hohe Anteil der Volunteers, die größtenteils ehrenamtlich für die Festivals arbeiten. Gut 60 Prozent der Leitungspositionen in den Festivals ist männlich besetzt, und nur gut 30 Prozent weiblich.
Zwar wurde während der Pressekonferenz des Öfteren betont, wie wichtig Jazz und improvisierte Musik auch für diese Studie gewesen seien. Doch so richtig nachvollziehen ließ sich das nicht. Im an die Präsentation anschließenden Expert/-innengespräch waren zwar Vertreter/-innen von Pop-, Rock- und Klassikfestivals auf dem Podium, aber niemand aus der Leitung eines Jazzfestivals. Auch in der Studie selbst spielt Jazz eher eine Nebenrolle, gerade einmal zwei O-Töne eines Jazzfestivalveranstalters finden sich darin als Zitate. Gerne hätte man auch detailliertere Angaben zu den Themen Nachhaltigkeit und Diversität bekommen, vor allem zur Geschlechterverteilung der auftretenden Musiker/-innen. Auch ein Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland wäre aufgrund der unterschiedlichen ökonomischen Rahmenbedingungen interessant gewesen.
Gravierend ist indes, dass man den zwei Hauptkategorien „Klassische Musik“ und „Popularmusik“ mehrere Subgenres wie Alte Musik oder Jazz zugeordnet hat, wodurch die Dichotomie von Klassik als Ernste Musik und Popularmusik als Unterhaltung noch mehr zementiert wird. „Die in dieser Studie vorgenommene Einteilung in die beiden Hauptkategorien ,Klassische Musik‘ und ,Popularmusik‘ sowie deren Subgenres beruht auf methodischen Erwägungen“, beteuern die Macher/-innen in einer Art Disclaimer: „Die Studie verfolgt in erster Linie das Ziel, die Festivallandschaft genreübergreifend zu beschreiben.“ Zum Schluss der Pressekonferenz kündigten die Macher/-innen an, dass eine Einzelauswertung für alle Subgenres, also auch für Jazz und improvisierte Musik, geplant sei.
Weiterführende Links
„Festivalstudie. Musikfestivals in Deutschland – Vielfalt, Strukturen und Herausforderungen“